Wenn ich Ihnen die folgenden Zeilen zitiere, werden Sie vermutlich wenig damit anfangen können:
Y aserejé, ja, de je
De jebe tu de jebere sebiunouva
Majabi an de bugui an de buididipí
Aserejé, ja, de je
De jebe tu de jebere sebiunouva
Majabi an de bugui an de buididipí
Aserejé, ja, de je
De jebe tu de jebere sebiunouva
Majabi an de bugui an de buididipí
Und doch bin ich mir ziemlich sicher, dass Sie diese Zeilen (vielleicht nicht 100 % korrekt, denn selbst auf Spanisch ist der Text Nonsens) schon einmal vor sich hingesummt haben. Damals, 2002, als Sie damit regelrecht überflutet wurden. Es ist der Refrain eines „Lieds“, das seinerzeit die Charts eroberte und dann genauso schnell wieder verschwand: Aserejé von Las Ketchup. Erinnern Sie sich?
Wenn Sie sich nun fragen, was das mit Politik zu tun hat, müssen Sie sich noch ein wenig gedulden. Zunächst eine andere Geschichte:
Während meiner Schulzeit hatte ich einen Musiklehrer, der sich für einen begnadeten Pianisten hielt und ein Faible für schwere klassische Musik hatte. Regelmäßig demonstrierte er der Klasse seine Fähigkeiten am Flügel – und erntete zunächst vor allem Gähnen.
Dann pflegte er zu sagen, er werde das Stück jetzt noch einmal spielen. Anschließend folgte meist eine dritte Wiederholung. Und siehe da: Es regte sich erstes Interesse. Plötzlich erwartete man mit Spannung bestimmte Passagen und konnte es kaum abwarten, sie wiederzuhören. Das Interesse verflog allerdings stets nach dem Unterricht. Aus mir wurde also nie ein Fan klassischer Musik. Der Grund war einfach: Ich hatte insgesamt zu wenig Kontakt damit.
Was hier beschrieben wird, nennt man in der Kognitionsforschung den Mere-Exposure-Effekt.
Dieser Effekt wurde erstmals in den 1960er-Jahren von Robert Zajonc beschrieben.
Im Kern besagt er:
Je häufiger wir einem Reiz ausgesetzt sind, desto positiver bewerten wir ihn – selbst ohne bewusste Auseinandersetzung oder tiefere Kenntnis.
Vereinfacht: Wiederholung erzeugt Sympathie.
Ohne diesen Effekt wäre die gesamte Musikindustrie aufgeschmissen. Sie verkauft nicht in erster Linie Qualität, sondern lebt fast ausschließlich von der Wirkung ständiger Wiederholung.
Wer glaubt, die Charts spiegelten musikalische Qualität wider, irrt. Tatsächlich beruhen sie auf Manipulation: Ein Lied wird nicht deshalb rauf- und runtergespielt, weil es erfolgreich ist – es wird erfolgreich, weil es rauf- und runtergespielt wird. Beim ersten Hören erzeugen viele moderne Songs eher Widerwillen oder Ablehnung. Erst durch wiederholte Konfrontation – etwa im Autoradio – steigt die Zustimmung. Erfolgreiche Interpreten oder Komponisten benötigen deshalb oft keine besonderen Fähigkeiten, sondern vor allem die richtigen Kontakte zu den Sendern.
Das erklärt auch, warum einem mit einigen Jahren Abstand oft fast peinlich ist, was man damals als Ohrwurm empfand – so wie beim eingangs erwähnten Hit von Las Ketchup.
Was in der Musik bestens funktioniert, gilt auch in Werbung und Politik. Parteien oder Kandidaten, die permanent präsent sind, werden mit der Zeit positiver wahrgenommen. So begegnete man in den Jahren 2020 und 2021 ständig einem Robert Habeck, einem Karl Lauterbach oder einer Annalena Baerbock – sei es im Fernsehen, in den sozialen Netzwerken oder in alternativen Medien. Entziehen konnte sich dem praktisch niemand.
Und heute? Heute dominieren Friedrich Merz und Alice Weidel die Bildschirme, gelegentlich ergänzt durch eine (inzwischen zurückhaltendere) Sahra Wagenknecht. Und natürlich Heidi Reichinnek von den wiederbelebten Linken.
Seit Frühjahr 2023 hat die AfD die stärkste Medienpräsenz, mit einer Ausnahme: In den Talkshows wurde das BSW um den Jahreswechsel 2024/25 durch die Linke abgelöst. Objektiv ist die Berichterstattung dabei keineswegs. Je nach politischem Kalkül wird eine Partei entweder in Grund und Boden kritisiert oder mit Wohlwollen behandelt. Auch das ist Teil gezielter Manipulation und durch negative Berichterstattung wird keinesfalls eine Ablehnung der Partei erzeugt, sondern lediglich eine andere Bevölkerungsschicht angesprochen. Wer nicht auf direktem Weg erreichbar ist, wird über den sogenannten Reaktanz-Effekt angesprochen. (Was es damit auf sich hat, habe ich an anderer Stelle ausführlich erläutert.)
Für den Mere-Exposure-Effekt entscheidend ist einzig die ständige Wiederholung.
Wie entkommt man dem Effekt?
Dem Mere-Exposure-Effekt zu trotzen, ist nicht leicht. Der Versuch, der medialen Dauerbeschallung zu entgehen, ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Was man jedoch tun kann, ist, sich den Mechanismus bewusst zu machen. Vielleicht empfindet man jemanden nur deshalb als kompetent, sympathisch oder geeignet, weil man genau das empfinden soll.
Hilfreich ist es, sich ins Gedächtnis zu rufen, wie man eine Person früher einmal beurteilte, bevor sie allgegenwärtig wurde. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, Menschen oder Parteien ausschließlich anhand nachprüfbarer Fakten zu bewerten – etwa an Programmen und tatsächlichen Erfolgen. Was wurde real politisch erreicht, und was sind bloß Lippenbekenntnisse, Forderungen oder polemische Ankündigungen?
Link zu diesem Beitrag
Und ohne Anchor-Tag



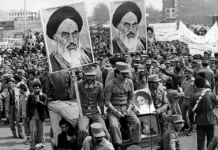








Haha, der Mere-Exposure-Effekt erklärt ja alles! Meine Lieblingsmusik ist jetzt plötzlich klassisch wegen ständiger Wiederholung im Autoradio – danke Robert Zajonc! Und Politik? Na klar, wer ständig im Fernsehen gesehen wird, wirkt doch automatisch kompetent. Mir wärs aber lieber, wenn die Charts mal Qualität hätten und nicht nur wiederholte Klischees. Und diese ganzen Parteien – jeder braucht nur seine eigene Wiederholungsmaschine. Na ja, wer braucht schon Fakten, wenn man eine gute Story (wenn auch manipuliert) hat? Und wer dieser Blog nicht indexiert, dem ist ja wohl ein Leid! Vielleicht sollten wir alle einfach mehr Kritikfähigkeit bewahren und nicht jedem Ohrwurm auf die Füße hüpfen.